
Inhaltsverzeichnis
Ich musste mir als Working Mom schon oft anhören, dass ich doch besser keine Kinder bekommen hätte, wenn ich sie dann schon mit 18 Monaten in die Krippe gebe. Oder warum ich überhaupt Kinder bekommen habe, wenn ich nicht bereit bin, auf meine Karriere zu verzichten. Für eine frisch gebackene Mutter gehört es in unserer Gesellschaft einfach nicht dazu, arbeiten zu gehen, wenn es keine finanzielle Not gibt.
Die Mutter wird durch das Kind geboren – und der Mensch vorher bleibt auf der Strecke?
Da merkte sich, wie sich das Blatt für Frauen wendet: Als Frau darfst du die Schule besuchen, dich bilden, du darfst studieren, du darfst dir eine Karriere aufbauen und eine Sprosse nach der anderen hochklettern.Aber: Sobald ein Kind kommt, ändert sich alles. Wenn du dann nicht deinen Beruf an den Nagel hängst und völlig in der Mutterrolle aufgehst, bist du egoistisch, geldgierig, selbstsüchtig. Natürlich möchte ich alles tun, dass meine Kinder glücklich werden. Doch mir ist bewusst geworden, dass ich bei dem ganzen Aufopferungs-Ding selbst auf der Strecke bleibe. Und ist eine unglückliche Mutter wirklich besser für ein Kind?
Ich hatte vor der Geburt meiner ersten Tochter wirklich nicht den blassesten Schimmer, was es heißt, sich um ein Kind zu kümmern. Ernsthaft, du wirst jetzt lachen, aber ich dachte durch meine rosarote Brille, dass das Baby dann den Großteil des Tages schläft und ich nebenbei den Haushalt mit links schaffe. Das bisschen Baby kann ja nicht so schlimm sein. Und dann wurde ich über Nacht nach ein paar Stunden Wehen mit einem 24 Stunden Job konfrontiert der mir schnell zeigte, dass zwischen Selbst- und Fremdbestimmung nur ein paar Presswehen liegen.
Ich fiel erstmals aus allen Wolken, als ich plötzlich eine Nachtschicht nach der anderen schieben musste und nicht mehr einmal in Ruhe zum Duschen kam. Ich konnte mein Baby nicht weinen lassen, es tat mir im Herzen weh. Und ich konnte es ja nicht einmal kurz abgeben, weil ich der Meinung war, niemand würde es mit meinem Kind schaffen. Aber nach ein paar Monaten merkte ich, dass es mich nicht so erfüllte wie gedacht, mich um mein Kind zu kümmern.
Mutter-Sein all inclusive war nichts für mich. Das erkannte ich schnell, als ich mich dem Drive der Jungmütter hingab und von einer Spielgruppe in die nächste hüpfte. Meine Nachmittage auf dem Spielplatz verbrachte und die meiste Zeit des Tages nichts anderes mehr tat als für mein Kind da zu sein und über mein Kind zu reden. Christoph und Lollo haben dazu ein passendes Lied geschrieben und genauso fühlte es sich an:
Wie groß es ist, ob es schon durchschläft, ob ich stille, wie ich entbunden hätte, ob ich einen Dammriss hatte und ob dieser schon verheilt ist – ich meine. WTF? Warum sollte ich so intime Details wie eine Geburt oder die Befindlichkeiten meines Damms plötzlich mit wildfremden Menschen besprechen? Weil ich aber las, dass Sozialkontakte meinem Kind gut taten, besuchte ich Spielgruppen weiterhin. Ich merkte schnell, dass ich nicht wie andere Mütter in so einem Brei der Glückseligkeit schwamm, sondern, dass mir etwas fehlte. Ich wartete immer noch, bis mein Muttergen an die Oberfläche kam und ich plötzlich Hirsestangen für mein Kind selber machte und dabei nicht nur glücklich, sondern überglück war. Oder Brei selber kochte und Gemüse auf dem Balkon anpflanzte. Einmal wagte ich in einer Spielgruppe das Thema „Wiedereinstieg“ anzusprechen. Da war mein Kind so etwa 4 Monate alt.
„Was? Du denkst schon wieder ans Arbeiten?“
„Sei doch froh, wenn du nicht arbeiten musst.“
„Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt schon wieder zu arbeiten. Ich meine, die ersten drei Jahre sind doch die wichtigsten für dein Kind.“
„Und überhaupt: Hast du schon die neue Studie gelesen, dass Kinder in Krippen furchtbar unter Stress stehen und sich das negativ auf die Entwicklung auswirkt?“
„Warum willst du denn wieder arbeiten gehen?“ wurde ich gefragt. „Weil es mir Spaß macht“ antwortete ich ehrlich. Doch ich kam mir vor, wie im falschen Film. Wo sind wir denn hier? Ist es nicht total rückschrittlich einer Frau, einer Mutter, die Selbstbestimmung über ihr Leben zu verwehren? Bei der Geburt reden wir alle noch groß von Selbstbestimmung und selbstbestimmten Gebären. Aber wenn es um die Frage geht, wie sich eine Mutter ihren weiteren Lebensweg mit Kind vorstellt, dann gilt es die Erfüllung von Klischees zu priorisieren.
Ich gebe zu, die Ich-rede-dir-jetzt-ein-schlechtes-Gewissen-ein-Masche funktioniert. Eine Mutter, die nicht mit ihrer ausschließlichen Mutterrolle glücklich ist, wird automatisch als schlechte Mutter schubladisiert. „Sei doch froh, dass du ein Kind hast. Viele Paare würden sich darüber freuen“. Das hat zwar niemand ausgesprochen, doch seitdem trug ich den Stempel „Rabenmutter“.
Wenn du dann einmal ein Kind hast, dann musst du dich anstrengen bis zur Erschöpfung. Und verdammt noch einmal, du hast dabei auch glücklich zu sein.
Alles was du tust wird als selbstverständlich wahrgenommen und es wird dir niemand dafür dankbar sein. Und egal wie sehr du dich anstrengst, es ist immer zu wenig. „Weißt du nicht, was du verpasst, wenn du wieder arbeiten gehst? Kinder werden so schnell groß“ habe ich oft gehört. Meinen Mann hat niemand gefragt, wie es ihm damit geht, dass er beim ersten Drehen, beim ersten Mal Krabbeln, bei den ersten Schritten oder dem ersten Wort nicht dabei war.
Wir sitzen alle im selben Sandkasten
Damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Ich liebe meine Kinder über alles. Ich habe sie gestillt, getragen, sie haben im Familienbett geschlafen, ich lese ihnen jeden Abend vor, ich begleite sie in den Schlaf, wir gehen auf Spielplätze, in den Wald und basteln Einladungskarten für den Kindergeburtstag selbst, ich tröste sie, ich lade sie für Mutter-Tochter-Gespräche auf einen Kakao ein, ich lache mit ihnen – „aber das soll alles sein?“ fragte ich mich oft. Kind als Lebenssinn und alles was vorher war ist nun vorbei?
Irgendwann spürte ich, dass ich nur dann eine gute Mutter bin, wenn es auch mir gut geht.
Und wann ging es mir gut? Wenn ich meinen Beruf, den ich sehr gerne machte, auch weiterhin ausüben konnte und dafür Anerkennung bekam. Denn genau das unterscheidet eine Arbeit vom Mutter-Sein:
Niemand, wirklich niemand hat mir jemals gesagt, wie toll ich meiner Aufgabe als Mutter nachkam. Stattdessen gab es unausgesprochene Vorschriften, Erwartungen und Haltungen, die es als Mutter zu erfüllen galt. Bei dem ganzen „du sollst als Mutter“ und „du musst als Mutter“ wird eines übersehen: Alles, was du als Mutter machst, wird von der Gesellschaft und auch von anderen Müttern als Pipifax bewertet. Im Wettstreit um den Orden „Beste Mami der Welt“ hatte ich oft das Gefühl, dass der echte Kontakt zu unseren Kindern auf der Strecke bleibt.
Für dein Kind zählt nicht, ob du den teuersten Kinderwagen hast, ausschließlich im Bio-Supermarkt einkaufen gehst, ihm nur fair trade Klamotten anziehst oder dein Kind in einem über-drüber-hyper-Frühförderungskurs anmeldest. Deinem Kind ist es egal, ob du zur Fraktion Bio-Mütter oder Burger-Mütter auf dem Spielplatz gehörst und ob „Also mein Kind kann schon…..“ dein Standardsatz ist. Dein Kind ist kein Statussymbol und es sagt nichts über deine Fähigkeit als Mutter aus, wenn du all diese Sachen tust. Kinder spüren, wenn sie ernst genommen werden. Und das wollen sie: Sie wollen ernst genommen und geliebt werden. Sie wollen als eigenständige Persönlichkeiten wahrgenommen werden und das vom ersten Tag an.
Ich bin keine Bilderbuchmutter
Und ich will auch keine sein. Ich weiß ja nicht einmal, was eine Bilderbuchmutter so macht.
Ich erlangte diese Erkenntnis erst, als ich mit einer inneren Stimme Friede geschlossen hatte. Eine innere Stimme, die mir immer sagte, dass eine gute Mutter in der Mutterrolle aufgeht. Dass eine gute Mutter nicht weg will von ihrem Kind, sondern so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen. Dass eine gute Mutter mit der Situation sich um das Kind zu kümmern ausgefüllt und zufrieden ist. Eine gute Mutter bleibt beim Kind zu Hause. Mindestens drei Jahre.
Und der gesellschaftliche Druck, der mich immer wieder dazu veranlasste Dinge zu tun oder über Dinge nachzudenken, die mir noch gar nicht in den Sinn kamen. Etwa, ob ich mein Kind verwöhne, wenn es in meinem Bett schläft oder wenn ich es trage. Aber ich war anders. Früher wäre ich gerne mal Glucke gewesen, so eine richtig glückliche Glucke. Ich habe viele Mütter darum beneidet, die scheinbar in ihrer Mutterrolle die Erfüllung gefunden hatten und nichts anderes mehr brauchten. Ich kam mir immer komisch vor und fragte mich selbst, was mit mir nicht stimmt. Warum mied ich Spielplätze immer mehr und fühlte mich in Spielgruppen nicht wohl? Warum fand ich keinen Anschluss in einer Mutter-Clique, wie es schienbar jeder anderen Mutter gelang?
Ich liebe meine Kinder, Über alles, aber ich liebe auch meinen beruf. Muss das ein widerspruch sein?
Dann stolperte ich über den Begriff „Mommy Burnout“ und dachte: Das ist es! Das steht mir bevor, wenn ich so weitermache. Ein Kinder-Kollaps.
Bindung ist nicht weiblich
Immer wieder wurde ich auch mit der Frage konfrontiert, wie ich das denn mit der Kinderbetreuung machen würde. Denn Krippen sind ja so schlecht und einer Tagesmutter kann man ja nicht trauen. „Da habe ich schon so viel Schlechtes gehört, ich sag es dir…..“. Wir haben uns die Betreuung schlichtweg geteilt, das war unsere Vereinbarung. Mein Mann und ich. Ich weiß, das ging nur, weil man sich aufopferte und einen flexiblen Job hatte, den er auch von zu Hause erledigen konnte.
„Was, dein Mann kümmert sich um dein Kind?“
„Du lässt dein Kind fremdbetreuen?“
„Du weißt aber schon, dass ein Kind zur Mutter gehört, oder?“
Dem möchte ich entgegenhalten: Dass sich ein Kind überhaupt an jemanden bindet ist ein Überlebenstrieb. Jedes Baby geht eine Bindung ein. Und diese Bindungsperson muss nicht die Frau sein, die das Baby ausgetragen hat, es kann auch eine Adoptivmutter, Pflegemutter, die Oma oder eine männliche Person sein. Babys sind da erstaunlich flexibel und binden sich an denjenigen, der ihre Bedürfnisse am besten erfüllt. Ohne eine Bindungsperson könnte es nicht überleben. Es sieht das eher pragmatisch. Und es muss auch nicht immer nur eine Person sein. Ein Kind ist erstaunlich flexibel, solange die Bindungspersonen flexibel sind. Und zum Thema „Beim Papa wird das Kind fremdbetreut“ sage ich gar nichts mehr. Ich meine: Das ist der Papa. Das hat nichts mit Fremdbetreuung zu tun, zumal ich Fremdbetreuung schon als Begriff nicht mag. Wer den Papa als Fremdbetreuung sieht, hat vielleicht ein anderes Problem……
Ich arbeitete nur wenige Stunden pro Woche, weil ich ja auch noch stillte. Die nötige Milch war abgepumpt, bevor ich ging, wurde nochmals gestillt und zur Sicherheit war nicht nur ein Milchvorrat da, sondern auch noch Milchpulver. Für mein Kind war bestens gesorgt. Doch diese wenigen Stunden führten dazu, dass ich mich viel ausgeglichener fühlte. So unter Erwachsenen, wo es mal nicht um Kinder ging und wo ich intellektuell gefordert wurde. Ich liebte meinen Job und war froh, nicht nur mein Kind als Verantwortung zu haben.
Die anderen Tage verbrachte ich damit, weiterhin mit meinem Kind in Spielgruppen aufzutauchen und mir langsam das Standbein „Home Office“ aufzubauen. In den Spielgruppen war ich die Exotin, die Egoistin, die Rabenmutter, weil 3 Jahre sollten es halt schon sein, die man beim Kind zu Hause bleibt. Ich bin aber nicht man, ich bin ich. „Du hast ja eh keine finanziellen Sorgen“ hörte ich immer wieder. Als wäre das in den Augen vieler Mütter der einzig akzeptable Grund, wieder arbeiten zu gehen.
Es ging nicht um finanzielle Sorgen. es ging darum, dass ich mich nicht immer rechtfertigen muss für etwas, das mein persönliches Lebensmodell ist. Und dafür brauche ich auch keinen grund, der gesellschaftlich akzeptiert ist.
Damit bin ich keineswegs eine Exotin, denn wenn du um dich schaust wirst du merken, wie viele Mütter täglich arbeiten. Ich stehe für viele Mütter. Ich bin die Leiterin im Kindergarten, ich bin die Apothekerin, ich bin die Bäckerin, ich bin die nette Dame an der Kassa, ich bin die Steuerberaterin, ich bin die Physiotherapeutin, ich bin die Ärztin, ich bin die Taxifahrerin, ich bin die Regalschlichterin, ich bin die Radiomoderatorin und die Wetterfee. Berufstätige Mütter sieht man überall.
Warum es Männer leichter haben
Frauen und Männer zu vergleichen funktioniert nur in der Theorie, denn da sind sie gleichgestellt. Dass die Praxis ganz anders aussieht, habe ich selbst erfahren. Wenn ich von meiner Berufstätigkeit erzählte, dann arbeitete ich nur „nebenbei“. Ich hatte gesellschaftlich betrachtet nicht „nebenbei“ ein Kind, sondern „nebenbei“ einen Job. Aber kann ich überhaupt „nebenbei“ ein Kind haben? Als Frau nicht. Da bin ich Mutter und damit ist mein Kind die Hauptaufgabe. Ich finde das total rückschrittlich und altmodisch. Mein Mann jedoch, der hatte „nebenbei“ ein, zwei, drei Kinder. Der Job stand an oberster Stelle. Mein Mann, der nach zwei Wochen Urlaub nach der Geburt wieder in seinen Vollzeitjob mit Überstundenpauschale und Auslandsreisen zurückkehrte, musste sich solche unsäglichen Bemerkungen nicht gefallen lassen.
Er wurde als Held gefeiert, wenn er das Kind mal abholte oder sich einen Tag Pflegefreistellung für die Betreuung nahm. Als sich mein Mann ein Jahr Elternteilzeit nahm, wurde er von vielen Männern als Weichei eingeschätzt. Von den Frauen hingegen erfuhr er eine Reaktion, die mich empörte: Er wurde heroisiert. Dafür, dass er ein Jahr lang ein bisschen mehr mithalf, ein bisschen mehr zu Hause war – doch was war mit mir, die auf fast alles verzichten? Väter, die einen ganzen Nachmittag in der Woche auf dem Spielplatz verbringen und ihre wertvolle Zeit für das Kind opfern sind unangreifbar. Doch unsere Situation hatte sich damals ein wenig angeglichen. Er wurde im Job dafür belächelt, dass er sich nun aktiv in die Familie einbrachte – zumindest für ein Jahr. Somit war er in derselben Situation wie ich, die gerne weniger Zeit mit ihren Kindern verbracht hätte und deswegen als Rabenmutter galt.
Mein Mann, der während seiner Berufstätigkeit noch zwei weitere Male Vater wurde, kann so viel arbeiten wie er will, er kann auf so viele Geschäftsreisen fahren wie er will, er kann seinen Hobbys nachkommen, erst spät abends nach Hause kommen wenn das Kind schon schläft und am Wochenende noch auf seine Freizeit und Erholung von der Arbeitswoche bestehen, er bekommt eines nicht: Den Stempel „Rabenvater“.
Warum muss ich mich als Frau eigentlich dafür rechtfertigen, aus welchem Grund ich auch weiterhin meinem Beruf nachgehe? Ich arbeite, weil ich meinen Beruf liebe und ihn mit großer Freude ausübe. Auch weil es mir und meiner Familie finanzielle Sicherheit bietet. Muss ich das wirklich erklären? Jede Mutter arbeitet und jeder Vater arbeitet – der Unterschied liegt nur in der Bezahlung. Ich hoffe, dass meine Kinder eines Tages genauso wie ich den Kopf darüber schütteln können.



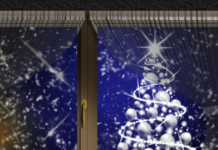



Stimmt zum Teil. Beim Vater ist es nicht so schlimm wenn er länger arbeitet und abends noch arbeitet und früher aus dem Haus geht weil er arbeiten muss. Das Kind versorgt schon die Mutter. Sie hat ja mehr Zeit. Sie arbeitet ja nur Teilzeit. Und kann sich auch um so vieles anderes kümmern, da sie ja nur Teilzeit arbeitet. Und sobald sie anmerkt, dass sie sich überfordert fühlt und gerne etwas Unterstützung hätte, zumindest am Wochenende, hört man von den Schwiegereltern: Was willst du eigentlich?? Sei doch froh dass er einen so guten Job hat und diesen auch gewissenhaft erledigt! Das ist ja alles nicht selbstverständlich….